
Batterien und Akkus werden künftig noch wichtiger bei Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Mobilität. E-Lyte bietet eine optimierte Elektrolyt-Lösung für jeden Anwendungsfall mit dem Ziel, Batterien im industriellen Einsatz leistungsfähiger, langlebiger und weniger störanfällig zu machen.
© Bild: E-Lyte
Duplikat von Duplikat von Duplikat von Duplikat von Duplikat von Duplikat von Duplikat von Duplikat von Duplikat von Duplikat von Duplikat von E-Lyte: die perfekte Elektrolyt-Lösung für jede Batterie (This content is only available in German.)
Sebastian Staiger (Head of Marketing/PR)
Wie kommt man darauf, die perfekte Elektrolytlösung zu entwickeln? Und vor allem: Wie geht man vor? Wer kann einen bei dem Vorhaben unterstützen? Denn eine solche Geschäftsidee erfordert neben einem Team vom Fach vor allem eins: Geld. Geräte, Laborkapazitäten, Entwicklungszeiten – das alles ist kostspielig und für ein junges Start-up nicht ohne Unterstützung aus Forschung und Industrie zu bewerkstelligen. Sebastian Staiger verrät uns im Gespräch mit #GründenNRW Insights.
Idee und Motivation
Was hat euch inspiriert, eine App als Alltagsbegleiter für Patientinnen und Patienten mit chronischen Erkrankungen zu entwickeln?
Alexander Krawinkel: Die ursprüngliche Idee entstand, als wir uns im Rahmen eines Gründungswettbewerbs kennengelernt haben. Ziel des Wettbewerbs war es, eine Biosensor-Lösung für Krebs- und MS-Betroffene zu entwickeln. Dabei wurde uns bewusst, wie groß der Bedarf an digitalen Unterstützungsangeboten im Alltag chronisch erkrankter Menschen ist.
Mit Beginn der Covid-Pandemie rückte dann zunehmend Long Covid in den Fokus – und damit die Frage, wie man eine flexible Plattform gestalten kann, die verschiedene chronische Erkrankungen abdeckt und Betroffene langfristig begleitet. Aus dieser Kombination aus persönlichem Engagement, fachlicher Herausforderung und gesellschaftlicher Relevanz hat sich unser Projekt Schritt für Schritt weiterentwickelt.
Warum habt ihr euch entschieden, Fimo Health GmbH in NRW zu gründen? Welche Vorteile bietet euch der Standort – z. B. in Bezug auf Netzwerk, Förderung oder Märkte?
Alexander Krawinkel: Die Entscheidung, Fimo Health GmbH in Nordrhein-Westfalen zu gründen, war für uns naheliegend – nicht nur, da wir Gründer damals alle in NRW, insbesondere im Raum Bonn/Köln, lebten, sondern auch, weil genau hier die Wurzeln unserer Idee liegen.
NRW ist für uns seither der ideale Standort, um unser Unternehmen im Bereich Digital Health weiterzuentwickeln. Die Region verfügt über eine exzellente Hochschul- und Forschungslandschaft. Besonders hervorheben möchten wir die enge Verbindung zur Uniklinik Köln sowie unsere Zusammenarbeit mit dem Gateway Gründungszentrum der Universität zu Köln. Darüber hinaus bestehen Forschungskooperationen mit weiteren Universitäten, die für unsere Produktentwicklung und klinische Validierung von großer Bedeutung sind.
Auch das Netzwerk in NRW ist ein klarer Vorteil: Initiativen wie die NRW.BANK, verschiedene Acceleratoren und branchenspezifische Förderprogramme bieten uns nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch Zugang zu wertvollen Partnern und Mentor*innen. Zudem profitieren wir vom wachsenden Digital-Health-Ökosystem in der Region – ein Umfeld, das Innovationen im Gesundheitsbereich aktiv vorantreibt und den Austausch zwischen Start-ups, Forschung, Versorgung und Industrie fördert.
Alles in allem bietet NRW für uns die perfekte Kombination aus lokaler Verankerung, wissenschaftlicher Exzellenz und unternehmerischer Infrastruktur – eine starke Basis für nachhaltiges Wachstum und gesellschaftlichen Impact.
Technologie und Innovation
Auf welcher technologischen Grundlage basiert eure App, und was unterscheidet euren Ansatz von bestehenden Gesundheits-Apps am Markt?
Alexander Krawinkel: Unsere App basiert technologisch auf Flutter, einem modernen Open-Source-Framework von Google, das die Entwicklung als plattformübergreifende Lösung ermöglicht. Damit stellen wir sicher, dass Nutzerinnen und Nutzer – unabhängig vom Betriebssystem – eine konsistente, performante und hochwertige Nutzererfahrung erhalten. Gleichzeitig erlaubt uns diese technologische Basis eine hohe Entwicklungsgeschwindigkeit und Flexibilität bei der Umsetzung neuer Funktionen oder Krankheitsbilder.
Was uns wesentlich von anderen Gesundheits-Apps unterscheidet, ist unser Plattformansatz: Statt für jede chronische Erkrankung eine eigene Anwendung zu entwickeln, vereinen wir in einer einzigen App eine Vielzahl individuell zugeschnittener Inhalte und Funktionen – aktuell für sechs Krankheitsbilder, bald für über fünfzehn. Trotz dieser Breite legen wir großen Wert auf Tiefe und Qualität: Die App ist CE-zertifiziert als Medizinprodukt und passt sich in ihrer Struktur, Sprache und Funktionalität jeweils an das spezifische Krankheitsbild an.
Auch im Bereich UI/UX setzen wir bewusst neue Maßstäbe: Unsere App ist nicht nur funktional, sondern auch grafisch ansprechend und interaktiv gestaltet. Nutzerinnen und Nutzer sollen sich intuitiv zurechtfinden, motiviert bleiben und ihre Fortschritte visuell nachvollziehen können – gerade im Bereich chronischer Erkrankungen ist diese positive Nutzererfahrung essenziell, um langfristig dranzubleiben.
Durch die Kombination aus technologischer Skalierbarkeit, regulatorischer Tiefe und einer klar auf die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten ausgerichteten Gestaltung schaffen wir einen Alltagsbegleiter, der sowohl medizinisch fundiert als auch menschlich nahbar ist.
Mit welchen technologischen oder regulatorischen Herausforderungen wart ihr bei der Entwicklung konfrontiert – und wie habt ihr sie gelöst?
Alexander Krawinkel: Die Entwicklung einer digitalen Gesundheitsanwendung – insbesondere als Medizinprodukt – bringt eine Vielzahl komplexer technologischer und regulatorischer Herausforderungen mit sich. Dazu zählen insbesondere die Anforderungen an die CE-Zertifizierung, den Datenschutz (insbesondere nach DSGVO), den sicheren Umgang mit Gesundheitsdaten sowie die Einhaltung relevanter Normen wie ISO 13485 (Qualitätsmanagement für Medizinprodukte) und ISO 27001 (Informationssicherheit). Hinzu kommen medizinisch-wissenschaftliche Nachweise zur Wirksamkeit der App, die für eine langfristige Anerkennung und mögliche Erstattungsfähigkeit essenziell sind.
Gerade als interdisziplinäres Gründerteam war es eine enorme Herausforderung, diese Vielzahl an Anforderungen nicht nur zu verstehen, sondern auch konsequent in Entwicklung und Organisation umzusetzen. Wir haben uns intensiv in die regulatorischen Grundlagen eingearbeitet, uns frühzeitig mit anderen Teams und Start-ups im Bereich Digital Health vernetzt und gezielt Beratung durch externe Expertinnen und Experten in Anspruch genommen – etwa in den Bereichen Regulatory Affairs, Datenschutz und Qualitätsmanagement.
Durch diese enge Verzahnung von Eigeninitiative, Kooperation und professioneller Unterstützung konnten wir einen strukturierten Zertifizierungsprozess aufsetzen, alle Anforderungen systematisch abbilden und gleichzeitig unsere technologische Flexibilität erhalten. Dieser Weg war sicherlich nicht der einfachste, aber er hat uns ermöglicht, eine tragfähige und zukunftsfähige digitale Gesundheitslösung zu schaffen, die sowohl den Anforderungen der Patientinnen und Patienten als auch denen der regulatorischen Landschaft gerecht wird.
Gründung und Aufbau
Wie verlief euer Weg von der Idee zur Gründung?
Alexander Krawinkel: Die Grundlage für unsere Gründung wurde bei einem Hackathon gelegt, bei dem es darum ging, technologische Lösungen für Menschen mit chronischen Erkrankungen wie Krebs oder MS zu entwickeln. Dort haben Dominik und ich uns kennengelernt – wir haben schnell gemerkt, dass wir nicht nur fachlich gut harmonieren, sondern auch die gleiche Motivation teilen: digitale Gesundheitslösungen zu entwickeln, die im Alltag der Betroffenen wirklich helfen.
Um das Team zu vervollständigen, haben wir Bene mit ins Boot geholt – ein IT-Experte, den Dominik bereits aus dem Studium kannte. Mit ihm konnten wir unsere technische Vision umsetzen und die App-Entwicklung starten.
Ein entscheidender Meilenstein war die erste Forschungsförderung, die uns nicht nur finanziell, sondern auch inhaltlich den Rücken gestärkt hat. Sie verschaffte uns den nötigen Freiraum, um aus einer Idee ein strukturiertes Produktkonzept zu formen– und schließlich auch den Schritt zur offiziellen Gründung der Fimo Health GmbH zu gehen.
Von Anfang an war klar: Unser Weg würde komplex, aber auch enorm sinnstiftend sein – und genau das treibt uns bis heute an.
Gab es schwierige Momente, und wie habt ihr diese gemeistert?
Alexander Krawinkel: Ja – davon gab es tatsächlich viele. Besonders herausfordernd war für uns der Umgang mit regulatorischen Anforderungen. Die Zertifizierung als Medizinprodukt, der Datenschutz, die Einhaltung von ISO-Normen – all das war Neuland für uns und mit enormem Aufwand verbunden. Hier halfen uns vor allem Ausdauer, die Zusammenarbeit mit externen Expertinnen und Experten und der kontinuierliche Austausch mit anderen Gründungsteams, die ähnliche Hürden bewältigt hatten.
Ein weiteres zentrales Thema war – wie bei vielen Start-ups – die Finanzierung. Gerade in der frühen Phase mussten wir immer wieder kreative Wege finden, um unsere Idee am Leben zu halten und weiterzuentwickeln. Förderprogramme, Wettbewerbe, Netzwerkveranstaltungen und strategische Partnerschaften waren dabei entscheidend. Aber auch eine Portion Glück und das richtige Timing haben sicher geholfen, zur richtigen Zeit die passenden Türen zu öffnen.
Was uns in den schwierigen Momenten am meisten geholfen hat, war unser Teamzusammenhalt. Die gemeinsame Überzeugung, dass unser Produkt einen echten Unterschied im Leben chronisch erkrankter Menschen machen kann, hat uns immer wieder motiviert, dranzubleiben – auch wenn der Weg manchmal steinig war.
Wie habt ihr eure Finanzierung aufgestellt? Gab es Unterstützung durch Förderprogramme, Investoren oder andere Partner?
Alexander Krawinkel: Unsere Finanzierung haben wir von Beginn an auf mehreren Säulen aufgebaut. Ein zentraler Baustein war die Unterstützung durch öffentliche Förderprogramme – sie haben uns vor allem in der frühen Phase entscheidend geholfen, unsere Idee zur Marktreife zu entwickeln. Dazu zählten unter anderem das EXIST-Gründerstipendium vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, das Gründerstipendium NRW sowie Start-up Transfer.NRW, mit dem wir unsere wissenschaftlichen Ansätze weiterentwickeln und erste prototypische Umsetzungen realisieren konnten.
Mit zunehmender Reife des Produkts und wachsendem Kapitalbedarf haben wir dann gezielt den Austausch mit Investorinnen und Investoren gesucht – insbesondere mit Fokus auf Impact und Digital Health. So konnten wir Venture-Capital-Partner gewinnen, die nicht nur finanziell, sondern auch strategisch an unserer Seite stehen. Diese Mischung aus Fördermitteln und VC-Finanzierung hat uns erlaubt, unser Wachstum nachhaltig aufzubauen, regulatorische Hürden zu nehmen und gleichzeitig flexibel auf Marktbedürfnisse zu reagieren.
Neben der finanziellen Unterstützung war für uns aber auch der Zugang zu Netzwerken, Coaches und Fachwissen über Fördergeber, Acceleratoren und Investoren hinweg ein großer Mehrwert – denn oft ist das „Wie“ der Umsetzung genauso wichtig wie das „Was“.
Erfolge und Zukunft
Auf welchen Erfolg seid ihr besonders stolz?
Alexander Krawinkel: Besonders stolz sind wir darauf, dass wir es geschafft haben, unsere App als CE-zertifiziertes Medizinprodukt für mittlerweile sechs chronische Erkrankungen erfolgreich auf den Markt zu bringen – mit weiteren Indikationen in Vorbereitung. Dieser Schritt war mit vielen regulatorischen, medizinischen und technischen Herausforderungen verbunden, aber er bildet das Fundament für unser Vertrauen bei Nutzerinnen und Nutzern, Ärztinnen und Ärzten sowie Partnern.
Ein weiterer Meilenstein, der uns besonders motiviert: Über 20.000 Patientinnen und Patienten haben unsere App bereits genutzt – und das mit sehr positivem Feedback. Zu sehen, dass unsere Arbeit reale Auswirkungen auf die Lebensqualität von Menschen mit chronischen Erkrankungen hat, ist für uns der stärkste Antrieb.
Nicht zuletzt sind wir stolz darauf, dass wir heute mit über 30 Krankenversicherungen zusammenarbeiten. Diese Partnerschaften zeigen, dass unser Ansatz nicht nur medizinisch und technologisch überzeugt, sondern auch im Versorgungssystem als relevanter Bestandteil wahrgenommen wird.
Diese Erfolge sind für uns keine Endpunkte, sondern Bestätigung und Ansporn zugleich, den Weg weiterzugehen – gemeinsam mit Patientinnen und Patienten, Partnern und dem Gesundheitssystem.
Wo seht ihr Fimo Health GmbH in den nächsten drei bis fünf Jahren? Welche Weiterentwicklungen plant ihr für eure App?
Alexander Krawinkel: In den kommenden drei bis fünf Jahren wollen wir Fimo Health als führende Plattform für das digitale Selbstmanagement chronischer Erkrankungen etablieren – international und indikationsübergreifend. Konkret planen wir, unsere App für über 30 verschiedene Erkrankungen anzubieten, individuell angepasst und weiterhin CE-zertifiziert. Damit möchten wir mehr als 10 Millionen Patientinnen und Patienten weltweit erreichen und unterstützen.
Ein zentraler Baustein dabei ist die Internationalisierung: Unsere App soll in mehr als 15 Sprachen verfügbar sein, um auch global den Zugang zu qualitativ hochwertiger, digitaler Versorgung zu ermöglichen.
Parallel dazu wollen wir unser B2B-Partnernetzwerk deutlich ausbauen. Unser Ziel ist es, mit über 500 Partnern aus dem Bereich Krankenkassen, Pharmaunternehmen und Versorgernetzwerken zusammenzuarbeiten – um gemeinsam neue Versorgungsmodelle zu entwickeln, den Zugang zur App zu erleichtern und eine nahtlose Integration in bestehende Gesundheitsstrukturen zu ermöglichen.
Technologisch werden wir die App kontinuierlich weiterentwickeln – mit KI-gestützter Personalisierung, neuen Sensor-Integrationen und erweiterten Funktionen zur Therapieunterstützung und Verlaufsdokumentation. Unsere Vision ist klar: Fimo Health soll der digitale Alltagsbegleiter für chronisch erkrankte Menschen weltweit sein – wissenschaftlich fundiert, regulatorisch sauber, menschlich nah.
Welche Entwicklungen oder Trends beobachtet ihr aktuell in der Gesundheits-Apps Branche – und wie wirkt sich das auf eure Arbeit aus?
Alexander Krawinkel: Aktuell erleben wir in der Digital-Health-Branche eine Phase, in der sich viel konsolidiert – und gleichzeitig die Herausforderungen für Start-ups steigen. Besonders im Bereich der Monetarisierung ist die Situation anspruchsvoll: Es gibt zwar verschiedene Wege wie Selbstzahlermodelle, Selektivverträge mit Krankenkassen oder die Aufnahme in das DiGA-Verzeichnis. Doch alle diese Pfade sind mit hohem Aufwand, komplexer Regulierung und begrenzter Skalierbarkeit verbunden.
Wir spüren diese Dynamik auch in unserer eigenen Arbeit – und haben daher entschieden, unseren Fokus verstärkt auf die Selbstzahler-Version unserer App zu legen. Dieser Ansatz erlaubt es uns, flexibler auf die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzern einzugehen, schneller zu iterieren und vor allem international zu denken. Wir sehen darin aktuell die beste Chance für nachhaltiges Wachstum und Skalierung, ohne uns zu sehr von nationalen Strukturen abhängig zu machen.
Gleichzeitig beobachten wir, dass der Markt insgesamt reifer wird: Patientinnen und Patienten sind informierter, die Erwartung an Usability und Qualität steigt, und auch der Bedarf an evidenzbasierten Lösungen wächst. Für uns ist das Ansporn, unser Produkt kontinuierlich weiterzuentwickeln – technologisch, medizinisch und nutzerzentriert.
Langfristig glauben wir weiterhin an die große Relevanz von digitalen Gesundheitsanwendungen – aber in der aktuellen Phase kommt es stark darauf an, realistische Geschäftsmodelle, hohe Produktqualität und strategische Flexibilität miteinander zu verbinden.
Tipps für Gründende
Was war die wichtigste Lektion, die ihr als Gründende gelernt habt und welche Tipps habt ihr für andere Gründende?
Alexander Krawinkel: Eine der wichtigsten Lektionen für uns – insbesondere im Gesundheitsbereich – war, von Anfang an sehr klar zu hinterfragen: Wer zahlt eigentlich für unsere Lösung – und warum? Es reicht nicht, ein gutes Produkt zu bauen. Entscheidend ist, frühzeitig ein realistisches Geschäftsmodell mit klarer Zahlungsbereitschaft zu entwickeln – und dabei auch selbstkritisch zu prüfen, ob der Nutzen aus Sicht der Kostenträger wirklich überzeugend ist. Gerade im komplex regulierten Gesundheitswesen darf man diesen Aspekt nicht erst „nachträglich“ mitdenken.
Eng damit verbunden ist die Regulatorik: Sie ist kein nachgelagertes Thema, sondern muss von Beginn an strategisch mitgedacht und sauber integriert werden – sei es CE-Zertifizierung, Datenschutz oder Nachweispflichten. Wer das frühzeitig berücksichtigt, spart sich später enormen Aufwand.
Ganz allgemein haben wir gelernt, wie wichtig es ist, die Finanzierung langfristig zu planen – und immer etwas mehr Zeit einzuplanen, als man denkt. Förderanträge, Investorengespräche, Vertragsverhandlungen – all das dauert oft länger als erwartet. Frühzeitige Vorbereitung ist hier Gold wert.
Und trotz aller Herausforderungen gilt: Den Spaß an der Sache nicht verlieren. Gerade in schwierigen Phasen ist die eigene Motivation und die Begeisterung fürs Thema das, was einen trägt – als Team und als Gründer*in.
Weitere Information:


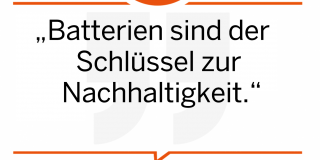
Social media settings
By activating these fields by clicking, information will be send to the following services and saved there:
Facebook, X, YouTube, Google, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Please read carefully our notes and information on Data Privacy and Netiquette (in German) before you activate individual social media.
Activate data feeds from Social Networks permanently and consent to data transfer: